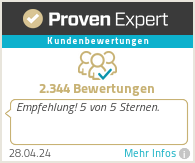Der arme Poet von Carl Spitzweg
Er sitzt auf seiner Matratze, in einer engen Dachkammer: der arme Poet. Zwei üppige Kissen stützen den Mann mit dem am Ellbogen geflickten Gewand und der weißen Schlafmütze, deren Zipfel keck nach oben ragt. Die große helle Decke, unter der er die Knie angewinkelt hat, hüllt ihn bis zur Brust ein. Er wirkt beschäftigt, angestrengt, mit dem, was er offenbar formulieren, aufs Papier setzen will: Seine linke Hand hält den Schreibbogen auf den Knien. Seine rechte scheint, mit dem Zeigefinger die Spitze des Daumens berührend, eine Geste der Konzentration, des Ringens um Präzision des Ausdrucks zu kennzeichnen. Um ihn herum sind die Dinge verteilt, die seine Person charakterisieren: die übergroßen Bücher, Wissensspeicher oder Ratgeber, die ihm auch als Möbel dienen, der Regenschirm unter der Decke, der auf das mangelhafte Dach hinweist, das kleine Fenster in der Nische, das wenig Licht hereinlässt. Es ist noch halb verdeckt vom Zylinder und schadhaftem Haushaltstuch. Unverhältnismäßig groß ist der Kaminofen, in dem allerdings nicht mehr genutztes Papier steckt.
Es ist bezeichnend, dass die Dunkelheit dieser Dachstube keine Rolle für die Szene spielt. Der Maler zeigt den Poeten in seinem Bett dafür in heller Farbe, so, als ob von ihm selbst ein Licht ausgehe. Auch dies kennzeichnet seine Bezogenheit auf sich und seine Aufgabe, die ihn von der umgebenden Räumlichkeit innerlich trennt. Sie unterstreicht, dass er im Fokus der Thematik steht. Auch ist seine Person selbst nicht in den Mittelpunkt der Komposition gestellt, ohne dass sie dabei an Bedeutung für die Aussage verliert.
 Der arme Poet Detail 1
Der arme Poet Detail 1
Der Mensch und sein Lebensraum
Die fein gezeichnete, detailreiche Darstellung, die man auch auf Kunstdrucken wie diesem hier erkennen kann und der Authentizität wegen muss, ist typisch für Spitzweg, aber ebenso für einige seiner künstlerischen Zeitgenossen. Sie fällt bereits bei
Caspar David Friedrich (1774-1840) auf, mit dem die romantische deutsche Malerei in erster Linie identifiziert wird. Jedoch steht bei ihm das Naturerlebnis in symbolhafter Bedeutung im Vordergrund: Der Blick in die Ferne ist hier stets auf eine höhere Wahrheit gerichtet. Aber Figur und Interieur oder umgebende Natur befinden sich bei Spitzweg in optisch vergleichbarer Beziehung: Auch hier ist der Mensch in den Raum gestellt, klein, aber nicht unbedeutend. Vom Motiv her lassen sich z. B. Friedrichs „Auf dem Segler“ (1818) und „Frau am Fenster“ (1822) anführen.
Allerdings fehlen bei ihm das die Person charakterisierende Ambiente, sowie auch die feine Ironie, die die Szene bei Spitzweg so menschlich macht. Obwohl in der Zeichnung gröber, sind auf dieser Ebene Darstellungen von Spitzwegs Zeitgenossen
Honoré Daumier (1808-1879) analog gekennzeichnet: Auch „Der eingebildete Kranke“ (1860) zeigt eine doppelsinnige Interieurszene. Zwei Personen sind dem Bettlägerigen im Krankenzimmer mit interessiertem Blick zugewandt. Jedoch macht ihr Mienenspiel in der Übersteigerung des mitleidvollen Ausdrucks ihre Intentionen fragwürdig, wie auch die Mimik des Kranken Zweifel offenbart. Daumier zeigt ebenfalls die kleinbürgerliche Lebenswelt oder die der unteren Gesellschaftsschichten auf, aber seine humoristischen Darstellungen sind geprägt von beißendem Humor und sozialer Kritik. Sie sind nicht romantisch, sondern realistisch im Ausdruck. Ebenso wie bei Spitzweg stehen die abgebildeten Personen miteinander in Verbindung, jedoch fehlt bei Spitzweg die negative Seite dieser Gegenüberstellung. Spitzwegs Menschen befinden sich in Harmonie miteinander oder, wie beim armen Poeten, mit sich selbst. Zusammen mit dem sie umgebenden Lebensraum zeichnen die Szenen eben jenes romantische Idyll auf, das sie so liebenswürdig macht, bei aller unterschwelligen Ironie und Kritik an ihrer biedermeierlichen Kleinbürgerlichkeit.
Motive, Themen und ihre malerische Gestaltung
Es ist gut möglich, dass Spitzweg sich thematisch an literarische Darstellungen August von Kotzebues (1761–1819) oder August Friedrich Langbeins (1757–1835) angelehnt hat. Ein Selbstbildnis des italienischen Malers Tommaso Minardi, entstanden um 1807, mit sehr ähnlicher Detailausführung des Arbeitsraums, war ohne Zweifel eine optische Vorlage. Zeitlebens in München ansässig, suchte der künstlerische Autodidakt dennoch Inspirationen auf Reisen. Sie führten ihn u. a. nach Italien, in die Schweiz, nach Paris und London oder ins heimische Bayern. Häufig war er dabei in Begleitung des Landschaftsmalers Eduard Schleich (1812-1874), der ihn auch künstlerisch beeinflusste. Die Art seiner Naturauffassung legt es nahe zu vermuten, dass Spitzweg dort erste Vorbilder in diesem Themenbereich suchte, hin zu einer freieren und lockereren Darstellung. Weitere Anregungen brachten ihm der Kontakt mit Künstlern der Schule von Barbizon, die sich ebenfalls von der idealistischen Naturauffassung im Bild distanziert hatten, und englischen Malern wie John Constable. Denn nicht nur die Enge des häuslichen Zimmers ist Bezugsraum für Spitzwegs Figuren, sondern auch der Garten, der Hof oder das Stückchen Erde mit begrenzender Architektur und Pflanzenbewuchs oder gleich der Aufenthalt mitten in der Natur selbst.
Szenen dieser Art zeigen z. B. die Bilder „
Die Jugendfreunde“ (1855) und „
Der Schmetterlingsjäger“ (1840). Auf einer Reise nach Prag 1849 beeindruckten den Künstler nach eigenen Angaben auch Ausdrucksweisen realistischer Malerei, vor allem von Josef Navrátil. Mit der aufgelockerten Naturdarstellung, wie sie besonders in Spitzwegs Bildern der 1860er Jahren deutlich wird, verlor sich die zeichnerische Präzision der Anfangszeit. So verweisen einige Ausführungen mit Licht durchflutender Szenerie schon hin auf eine impressionistische Auffassung.
 Der arme Poet Detail 2
Der arme Poet Detail 2
Das Bild und seine Geschichte
„Der arme Poet“ ist ein frühes Werk des Malers und Illustrators. Die Bildidee nahm bereits 1837 Formen an. In diesem Jahr entstanden die ursprünglichen Vorarbeiten, von einer Ölstudie bis zu einer ersten Fassung des Ölbildes. Sie befindet sich heute im Privatbesitz. 1839 stellte der Maler zwei weitere Versionen dieser Fassung fertig. Als er das Bild schließlich im selben Jahr in einer Ausstellung des Münchner Kunstvereins präsentierte, wurde es heftig kritisiert. Die ironische Auffassung eines Dichters als erfolgloser Künstler passte nicht in die gesellschaftliche Vorstellung der Zeit. Dennoch erhielt er 1865 den königlich-bayrischen „Verdienstorden vom heiligen Michael“. 1868 wurde ihm, der in jungen Jahren eine künstlerische Ausbildung an der Münchner Kunstakademie für sich abgelehnt hatte, die Ehrenmitgliedschaft dieser Institution verliehen.
„Der arme Poet“ in einer seiner beiden endgültigen Ausarbeitungen von 1839 gehört seit 1887 zur Gemäldesammlung der
Neuen Pinakothek in München. Es war eine Schenkung eines Neffen des Malers. Die Spur der zweiten Fassung von 1839, damals im Besitz der Neuen Nationalgalerie in Berlin, verlor sich 1989: Das Bild wurde Opfer eines Kunstraubs.
© Meisterdrucke
×




.jpg)
.jpg)
.jpg)
_1839_-_(MeisterDrucke-983934).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_1839_-_(MeisterDrucke-983934).jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-259533).jpg)
.jpg)
_Teniers_-_The_Alchemist_-_(MeisterDrucke-1630011).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Peinture_de_Thomas_Wyck_(Wyjc_-_(MeisterDrucke-1031296).jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-900054).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 - (MeisterDrucke-62585).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-394074).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 - (MeisterDrucke-240932).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 and Darius III (d330 BC) in 333 BC Roman floor mosaic removed from the Casa del Fauno (House of the Faun) - (MeisterDrucke-176569).jpg)
.jpg)
.jpg)
_-_(MeisterDrucke-598039).jpg)
.jpg)
.jpg)