

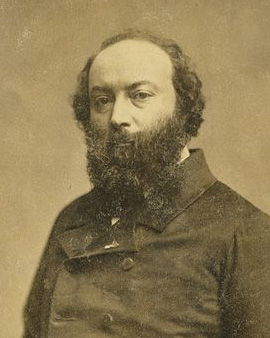
Abgeschiedene Wälder, stille Lichtungen, ungestörte Natur… Wonach wir uns sehnen, wurde im Umland von Paris schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine Seltenheit. Der Wald von Fontainebleau diente seit dem Mittelalter den Königen als Refugium, durch die Industrialisierung geriet er immer mehr in Gefahr. Gerade noch rechtzeitig wurde er von den Pleinairmalern entdeckt, die ihre grandiosen Naturlandschaften vor Ort auf die Leinwand brachten und dabei das Spiel des Lichtes, das Rauschen der Blätter und den Stolz der mächtigen Baumriesen mit dem Pinsel einzufangen versuchten.
Pierre Etienne Théodore Rousseau, geboren 1812, war einer der ersten, die diesen uralten Wald malten. Der Sohn eines Pariser Schneiders nahm schon früh Unterricht bei seinem malenden Cousin. Die damals in hohem Kurs stehende Historienmalerei war seine Sache jedoch nicht, schnell verließ er das Atelier seines hochgeachteten Lehrers wieder, zu künstlich und zu blutleer wirkten ihm sowohl die Sujets wie auch die Maltechnik. Rousseau wollte stattdessen das echte Leben und die wahre Natur mit allen Sinnen aufnehmen. Erste Studienreisen führten ihn in die Normandie und in die Auvergne, und was er dort fand, hoffte er auch in der Nähe seiner Heimatstadt aufzuspüren. Mit 20 Jahren nahm Rousseau erstmals Leinwand, Farben, Pinsel und Staffelei mit in den Wald von Fontainebleau, der nur 50 Kilometer südlich von Paris lag. Er wollte dort nicht nur nach der Natur zeichnen oder kleinformatige Ölskizzen anfertigen, sondern vollgültige Gemälde von den knorrigen Eichen, majestätischen Kiefern, aber auch von den formenreichen Sandsteinfelsen anfertigen, die seit jeher die Fantasie der Menschen anregten. Er schuf so die Gattung der Paysage Intime, der „vertrauten Landschaft“, die sich nicht dadurch auszeichnete, dass sie spektakulär war, sondern durch ihre schlichte Schönheit.
Seine Bilder hatten im Pariser Salon anfangs nur wenig Erfolg, doch allmählich wurden sie in der Kunstwelt wahrgenommen. Erste Malerkollegen gesellten sich in den 1830er Jahren zu ihm, und auch ihre Namen haben bis heute einen großen Klang: Jean-Francois Millet, Charles-Francois Daubigny oder auch Camille Corot. Aus dem Zusammenspiel dieser Künstlerindividuen, die die akademische Malweise ablehnten und stattdessen einen unmittelbaren Zugang zur Natur suchten, entstand die Schule von Barbizon, benannt nach einem Dorf im Wald von Fontainebleau. Rousseau ließ die Großstadt immer öfter hinter sich und zog schließlich im Jahre 1848 zusammen mit seiner Frau ganz hierher. Streng genommen handelt es sich jedoch nicht um eine Schule, sondern um eine Schulung der individuellen Kunstauffassung im direkten Dialog mit der umgebenden Natur. Auch der Künstlerkolonie von Barbizon ist es zu verdanken, dass der Wald von Fontainebleau zum ersten französischen Naturschutzgebiet erklärt wurde und bis heute erhalten ist. Theodore Rousseau starb 1867 im Alter von 55 Jahren in Barbizon, umgeben von seiner geliebten Natur, deren Facetten und Wandlungen er unablässig gemalt hatte. Was folgte, war wenig später der Impressionismus.
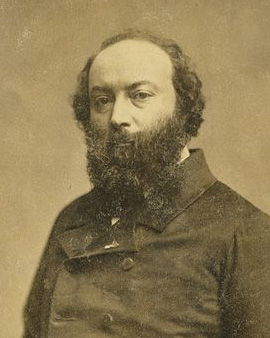
Abgeschiedene Wälder, stille Lichtungen, ungestörte Natur… Wonach wir uns sehnen, wurde im Umland von Paris schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine Seltenheit. Der Wald von Fontainebleau diente seit dem Mittelalter den Königen als Refugium, durch die Industrialisierung geriet er immer mehr in Gefahr. Gerade noch rechtzeitig wurde er von den Pleinairmalern entdeckt, die ihre grandiosen Naturlandschaften vor Ort auf die Leinwand brachten und dabei das Spiel des Lichtes, das Rauschen der Blätter und den Stolz der mächtigen Baumriesen mit dem Pinsel einzufangen versuchten.
Pierre Etienne Théodore Rousseau, geboren 1812, war einer der ersten, die diesen uralten Wald malten. Der Sohn eines Pariser Schneiders nahm schon früh Unterricht bei seinem malenden Cousin. Die damals in hohem Kurs stehende Historienmalerei war seine Sache jedoch nicht, schnell verließ er das Atelier seines hochgeachteten Lehrers wieder, zu künstlich und zu blutleer wirkten ihm sowohl die Sujets wie auch die Maltechnik. Rousseau wollte stattdessen das echte Leben und die wahre Natur mit allen Sinnen aufnehmen. Erste Studienreisen führten ihn in die Normandie und in die Auvergne, und was er dort fand, hoffte er auch in der Nähe seiner Heimatstadt aufzuspüren. Mit 20 Jahren nahm Rousseau erstmals Leinwand, Farben, Pinsel und Staffelei mit in den Wald von Fontainebleau, der nur 50 Kilometer südlich von Paris lag. Er wollte dort nicht nur nach der Natur zeichnen oder kleinformatige Ölskizzen anfertigen, sondern vollgültige Gemälde von den knorrigen Eichen, majestätischen Kiefern, aber auch von den formenreichen Sandsteinfelsen anfertigen, die seit jeher die Fantasie der Menschen anregten. Er schuf so die Gattung der Paysage Intime, der „vertrauten Landschaft“, die sich nicht dadurch auszeichnete, dass sie spektakulär war, sondern durch ihre schlichte Schönheit.
Seine Bilder hatten im Pariser Salon anfangs nur wenig Erfolg, doch allmählich wurden sie in der Kunstwelt wahrgenommen. Erste Malerkollegen gesellten sich in den 1830er Jahren zu ihm, und auch ihre Namen haben bis heute einen großen Klang: Jean-Francois Millet, Charles-Francois Daubigny oder auch Camille Corot. Aus dem Zusammenspiel dieser Künstlerindividuen, die die akademische Malweise ablehnten und stattdessen einen unmittelbaren Zugang zur Natur suchten, entstand die Schule von Barbizon, benannt nach einem Dorf im Wald von Fontainebleau. Rousseau ließ die Großstadt immer öfter hinter sich und zog schließlich im Jahre 1848 zusammen mit seiner Frau ganz hierher. Streng genommen handelt es sich jedoch nicht um eine Schule, sondern um eine Schulung der individuellen Kunstauffassung im direkten Dialog mit der umgebenden Natur. Auch der Künstlerkolonie von Barbizon ist es zu verdanken, dass der Wald von Fontainebleau zum ersten französischen Naturschutzgebiet erklärt wurde und bis heute erhalten ist. Theodore Rousseau starb 1867 im Alter von 55 Jahren in Barbizon, umgeben von seiner geliebten Natur, deren Facetten und Wandlungen er unablässig gemalt hatte. Was folgte, war wenig später der Impressionismus.
Seite 1 / 1






